Gundel Steigenberger
TEXTE - Deutschlandreise
Geschichten aus Deutschland
Aachen – MENSCHEN MIT KINDERN (2014)
Ich gehe in die warme, feuchte Vorhalle des Spaßbads und atme tief durch. Gott, ist das heiß. Und in diesem hier kann man sogar in den Schwimmbereich sehen, die Kinder kreischen hören. Das ist ja schrecklich; ich bin einigermaßen außer Atem, als ich am Kassendeck ankomme, umringt von Besucherhorden in den unterschiedlichsten Größen. Erziehungsberechtigte,
Hortgruppen und Krabbelgruppenmuttis drängeln durcheinander, dass es eine Freude ist.
Wir mussten außerhalb des gekennzeichneten Bereichs parken, sonst war nichts mehr zu kriegen. Der beste Ehemann von allen – sehr angespannt ob der vielen Menschen – kommt mit dem Kind zurück. Ist leider größer als ein Meter und muss deshalb Eintritt zahlen. Ehrlich jetzt? Ab vier ist die goldene Zeit der freien Eintritte vorbei. Aber nach Größe? Fehlte noch, dass sie den Eintritt pro Zentimeter über Null, also
über 1 Meter berechnen. Wir erläutern unser Anliegen. Wir möchten ins Schwimmbad,
nein 1 1/3 Stunden sind zu kurz, drei Stunden auch, also Tageskarte, und in die Sauna.
Die Kassiererin rastet aus. Eigentlich hebt sie den Zeigefinger, oder naja, beides. "Jetzt
will ich Ihnen mal was erklären!" Und dann folgt etwas, dessen Inhalt ich erst später in
eine folgerichtige, will heißen, verständliche Reihenfolge bringe. Jetzt am Eingang
verstehe ich nur: Das mache ich nicht. Eltern mit Kind Karten fürs Schwimmbad und die
Sauna verkaufen? Nee.
Unser Einwand: Machen wir schon lange so, war nie ein Problem, wird mit "Na, da
waren Sie aber nicht hier!" abgeschmettert. Das kann ich bestätigen. Wir waren noch
nie hier. Sie erklärt uns: Die Eltern wechseln sich ab, Gott bewahre, und zahlen nur
einmal, gehen dann aber beide in die Sauna. Ja, wollen wir nicht, wir hatten ja auch
zwei Karten verlangt. Nein, das ginge auch nicht, sie erlebe immer wieder, und ihre
Geduld sei hier jetzt wirklich am Ende, denn sie habe es immer wieder gesagt, und dann
hätten die Eltern gesagt: Ja machen wir, und dann hätten sie es doch nicht gemacht, so dass die Eltern beide in die Sauna gingen und die Kinder allein im Schwimmbad blieben. Ich protestiere: Das Kind ist allerhöchstens fünf! Beeindruckt sie nicht. Wir kaufen nur ein Karte, ich bekomme ein rotes Band um den Arm. Der beste Ehemann von allen sieht leicht frustriert aus, das ist schon der zweite Anlauf, in die Sauna zu kommen. Und immerhin regnet es seit zwei Tagen durchgehend. Ich sage: Jetzt kauf halt auch für dich eine, und dann erklärt sie uns, dann müssten wir auch für das Kind eine kaufen, wir dürften nur mit Kind in die Sauna.
Ein Fünfjähriger im Saunabereich? Das wird lustig, besonders für die anderen Gäste. Beeindruckt sie ebenfalls nicht. Wir zahlen, immerhin ist er schon fünf Zentimeter über Null. Der beste Ehemann von allen sieht wütend aus. Ich werfe entnervt die Bonuskarte hin, die die Kassierin uns ungefragt vorgelocht hat. Was es da wohl gegeben hätte, bei zehn Einträgen? Einmal umsonst in die Sauna ohne Kind? Sie ist ärgerlich. Hah! Geschafft! Ich kann's nicht genießen, mein Herz wummert vor gerechter Empörung. Beim Einmarsch scheitere ich trotz Familienkarte am Drehkreuz. Ich nutze die Gelegenheit und pflaume die Kassiererin an. Sie pflaumt zurück. Möglicherweise auch andersherum. Wir sind uns uneinig darüber, wer wessen Tag versaut hat. Der beste Ehemann von allen sieht vollkommen fertig aus. Wozu wollten wir eigentlich in die Sauna?

Erzgebirge – ANFAHRT (Schreibübung, zeitlos)
Vor einiger Zeit hatte ich einen Termin in Dippoldiswalde. Die Wegbeschreibung las sich in etwa so: Am Ortsausgang (von Oberbobritzsch) die S188 nehmend bis zur nächsten Kreuzung, dann auf der S189 bis Friedersdorf, dort auf der Frauensteiner Straße bleibend Richtung Süden die Hauptstraße erreichen, und dann weiter nach links, auf die S186, bis Hartmannsdorf. Hier keinesfalls auf der S208 bleiben, die nach Burkersdorf führt, oder an der Kreuzung nach rechts, wo es nach Kleinbobritzsch und weiter nach Frauenstein geht. In Hartmannsdorf dann auf der Hauptstraße bleiben, bis Reichenau, wo links abbiegend die B171 erreicht wird. Dann an der Talsperre Lehnmühle vorbei über Hennersdorf nach Sadisdorf, eine wunderbare Abfahrt ins Tal bis Unternaundorf, wo dann erneut links abbiegend die B170 erreicht wird. Dieser Straße über Obercarsdorf (Ulberndorfer Straße) und Ulberndorf (Altenberger Straße) schließlich bis nach Dippoldiswalde (Dresdner Straße) folgen.
Kein Ding, dachte ich.
Am Anfang ging auch alles gut. Am Ortsausgang von Bobritzsch stand ein Orstschild: 15 km bis Dippoldiswalde. Über eine kleine, schmale, schlaglöcherübersäte Landstraße holperte ich bis zum nächsten Ort, und gelangte nach etwa 10 Minuten Fahrt an eine T-Kreuzung mit einem Schild: Dippoldiswalde 15 km. Wider besseres Wissen folgte ich diesem Schild und gelangte auf eine einsame, schlaglöcherübersäte Landstraße. Ab und zu kreuzte ein Straßendorf meinen Weg, das nie ein Ende nahm. Mein Navi spielte verrückt. Es rechnete und überschlug sich mit Alternativrouten. Zuerst schlug es vor, ich wäre vielleicht bei Friedersdorf der Versuchung erlegen und nach Norden abgebogen, wo ich dann die Schönheit des Dorfkerns hätte bewundern können, jedoch bald nach Röthenbach gelangt wäre, wo es erst nach Pretzschendorf, dann rechts nach Hartmannsdorf und damit wieder zurück auf den richtigen Weg ginge.
Ungeachtet dieser nachvollziehbaren Überlegung stand ich irgendwann an einer Kreuzung, an der mein Fahrtziel überhaupt nicht angeschrieben war. Mein Navi hatte die Nase voll und verlangte zum Ausgangsort zurückzukehren. Ich vermutete vage, dass ich in Röthenbach nicht nach Süden, sondern in die entgegengesetzten Richtung über die Bergstraße, später Mühlenstraße und schließlich Beerwalder Straße ins Tal der Wilden Weißeritz gelangt war und den Abzweig nach Pretzschendorf verpasst hatte, wo ich einerseits nach Friedersdorf und von dort aus nach Hartmannsdorf oder nach Oberbobritzsch, also den Ausgangsort, hätte zurückkehren können. Unabhängig von der Straßenbeschilderung führten folglich alle Routen ungeachtet ihrer entgegengesetzten Richtung zum Ziel, weshalb ich jetzt frei nach Nase links abbog, um kurz darauf auf ein Schild mit der Aufschrift "Dippoldiswalde 5 km" zu stoßen.
Hat man einmal das romantische Tal der Wilden Weißeritz durchquert, dann ist Umkehren wenig sinnvoll, denn vom transvallischen Beerwalde aus hält man sich am besten links auf der Mühlenstraße bis nach Ruppendorf, und von dort rechts auf die Freiberger Straße und später auf die Ruppendorfer Straße, die nach Reichstädt führt, von wo man links auf die Talstraße abbiegt, die nach einiger Zeit in die Reichsstädter Straße übergeht und dann ist man auch schon am Ziel, wenn auch von der entgegengesetzten Seite.
Nur war die Weißeritz nirgendwo in Sicht. Möglicherweise hatte ich aus Versehen eine der Schleichrouten erwischt, zum Beispiel kann man sich in Beerwalde rechts auf der Mühlenstraße halten, woraufhin man nach kürzerer Strecke nach Reichstädt gelangt. Oder man nimmt noch diesseits des Flusstals in Hartmannsdorf die schon erwähnte Lehnmühler Straße, und kürzt dadurch den recht langwierigen Bogen um die Talsperre ab. Allerdings ist die Qualität der betroffenen Straßen fragwürdig und erfordert gesonderte Ausrüstung.
Ich beschloss mich an das trügerisch Offensichtliche zu halten und nahm an, ich wäre Dippoldiswalde schon nähergekommen, nur um mindestens zehn Kilometer später hinter einer mordsgefährlichen Baustelle an einer serpentinenähnlichen Kurve erneut ein Schild zu finden: Dippoldiswalde 4 km.
Die Straßenführung begünstigte die hier erforderliche Notausstieg-Strategie (frei nach Douglas Adams), das schnelle Im-Kreis-Fahren, bis man auf Fluchtgeschwindigkeit beschleunigt hat. Also tat ich genau das, fuhr stupide immer weiter, so schnell ich konnte, mit qualmenden Reifen, schneller und schneller, bis ich an einem Ortsschild vorbeirasend gerade noch die Aufschrift "Dippoldiswalde" erahnen konnte.
Aufgrund der hervorragenden Anfahrtsbeschreibung fand ich den Ort meines Treffens auch sofort. Leider war ich eine halbe Stunde zu spät.

Bayrische Alpen – DIE BESTEIGUNG DES ETTALER MANNDLS (2015)
Am 29. Dezember 2015, einem Dienstag, haben wir das Ettaler Manndl bestiegen. Das ist ein wunderschöner Berggipfel in der Nähe von Ettal – wo es übrigens ein eindrucksvolles Kloster gibt – eingebettet zwischen anderen wunderschönen Berggipfeln am Rande eines Tales, durch das die Loisach fließt. Man fährt mit der Seilbahn rauf – natürlich kann man auch zu Fuß gehen – und marschiert vibrierend vor Kraft und Ausdauer an den Ausflüglern vorbei, die in der winterlichen Inversionssonne am Bergpunkt beim Mittagessen sitzen. Dann geht es los, immer der Nase und den Wegweisern nach, meist nach unten, über einen Sattel bis zum Ettaler Manndl, das sich kalkfelsig aus den bewaldeten und winterlich mit vertrocknetem Gras bedeckten Ammergauer Alpen erhebt.
Menschenmassen sind unterwegs, denn es ist die Zeit nach Weihnachten, wo alle freihaben, und das Wetter ist sonnig, blauer Himmel, unglaubliche Sicht. Und natürlich will man da in die Berge, die einen fahren hoch und setzen sich auf die Terasse, bis das Hungergefühl sie überkommt, die anderen wandern ein wenig um den Gipfel herum, die nächsten starten morgens um acht aus Oberammergau, erreichen die Gipfel zu Mittagszeit, brotzeiten und steigen dann freihändig und mit den Bergschuhen wippend den Gipfel hinauf.
Die Sonne brennt, die Luft riecht nach Frühling, meine Bergjacke habe ich schon vor einer Stunde ausgezogen. Die lange Unterhose hätte ich mir sparen können. Jetzt beschließe ich doch die Mütze aufzusetzen, weil sie im Falle eines Sturzes den Kopf schützt. "Damit's weniger weh tut", erklärt mir mein bergwachterprobter Begleiter. Ich frage mich, ob das ehrlich noch zählt, wenn ich da herunterstürze, und entschließe mich spontan gegen ein Sicherungsgeschirr, weil ich mir die Blöße nicht geben will. Alles eine Frage der Psychologie!
Der Gipfel erhebt sich steil über mir, Menschen hangeln sich an einer Metallkette entlang, die den ganzen Weg nach oben Halt bietet. Die Steigung ist harmlos, der Fels ordentlich zerklüftet, so dass man überall gut Halt hat. Man muss noch nicht mal klettern können, Alltagsfähigkeiten und ein bisschen Selbstvertrauen reichen aus. Und es gibt ja überall diese Kette, an der man sich festhalten kann.
Wir klettern los. Ich als letztes, immer schön hinterher, brauche die Kette gar nicht. Nachdem wir höher und höher steigen – vielleicht vier, fünf Meter über dem schmalen Wanderweg, den wir gekommen sind – steigt die Furcht, abzustürzen. Gedanken, was schreckliches passieren könnte, wenn ich nach hinten fiele. Nicht nach unten gucken! Und ich bin nicht gesichert! Mann! Ich muss völlig bescheuert gewesen sein! Das Klettern selbst ist easy, kein Problem, hier komme ich ohne Probleme hoch, aber leider wird der leere Raum hinter mir, der sich bis zum Boden erstreckt, immer größer, immer bestimmender, immer gefährlicher. Er drückt in meinem Rücken, ich presse mich an den Fels, bloß nicht loslassen. Du brauchst keine Angst zu haben, diesen Felsen schaffst du locker. Die Angst ist das Problem, nicht der Fels. Den Felsen schaffst du, also verdränge nur die Furcht und alles wird gut.
Mein Atem beschleunigt sich, der Puls rast. Jetzt nur keine feuchten Hände kriegen. Nach einem Viertel der Strecke – oder geht es da oben etwa um die Ecke und ich sehe den eigentlichen Gipfel noch gar nicht? – müssen wir anhalten, weil uns jemand entgegen kommt. Wir beobachten einen Vater, der seinem Fünfjährigen beim Absteigen behilflich ist. Der Junge klettert konzentriert rückwärts, der Vater weist ihn an, nebenbei hält er das Seil, mit dem der Junge gesichert ist. Der beste Ehemann von allen zeigt unserem Kind die Szene, macht aber wenig Eindruck. Das Kind findet Klettern doof und auch die Tatsache, dass es an einem Kletterprofi hängt, der wiederum an einer Kette hängt – im Gegensatz zu dem Jungen, der nur am Profi hängt, oder zu mir, die an gar nichts hängt – vermag es nicht von der aufregenden Klettertour zu überzeugen.
Wenig später ist die Engstelle überwunden, wir steigen weiter bergauf, der Fels wird steiler – ich muss mich an der Kette festhalten, um Ecken und Kanten zu überwinden, ach was, ich muss mich an der Kette festklammern –, der Raum hinter mir ist ein riesiger weiter Raum voller Todesdrohungen, der den winzigen Felsen, an den ich mich klammere, zusammendrückt. Ich versuche den Gedanken zu verdrängen, dass ich wieder runter muss, und beschließe, einmal oben angekommen, für den Rückweg das Klettergeschirr anzulegen. Das beruhigt mich. Nicht, dass ich abstürzen könnte, die Kletterschwierigkeit ist niedrig, hier komme ich leicht hoch respektive runter, aber diese Angst. Sie lässt sich nicht abstreifen, sie bedrängt mich, ich bekomme sie einfach nicht los. Hier kann ich mich noch nicht mal gegen den Fels drücken, es ist zu steil, die Welt besteht nur noch aus weitem Raum, der mich hinabzieht, meine Hände schweißig werden lässt und Todesangst weckt. Scheißdrecksdumme Psychologie! Die kann auch gar nichts.
Das Kind hat keine Lust mehr, brüllt laut, es möchte jetzt aber nach Hause. Wir halten an. Ich könnte vorbeisteigen, aber dann müsste ich die Kette loslassen. Ich müsste um die Kette herumsteigen. Nach einer längeren Diskussion, während der von oben fünf oder sechs Kletterer an uns vorbeigegangen sind – freihändig und in perfekter Balance – entschließen wir uns umzukehren. Ich bin so erleichtert! Bis nach oben, das hätte ich nie geschafft. Ich wäre allein, weil ich mich davor fürchte, abgestürzt. Ich drehe mich herum, unter uns: eine Familie mit einer halbwüchsigen Tochter, die gerade eine Panikattacke erleidet, und sich heulend am Fels festklammert. Der zunehmend verzweifelte Vater redet beruhigend auf sie ein. Ich stelle fest, dass sie auch kein Klettergeschirr trägt.
Nun tut sich ein Problem auf: Ich trage keinen Gurt. Aber ohne runtersteigen? Nein, niemals. Ich entschuldige mich zehnmal bei meinem Kletterprofi, der es gelassen nimmt, aber mich im Geheimen von der Liste der Leute streicht, mit denen er jemals wieder wandern oder bergsteigen wird. Freihändig, am Berghang klammernd, lege ich das Klettergeschirr an. Ich schaffe es, mit beiden Beinen hineinzusteigen – erst das linke, dann das rechte – aber dann kriege ich den verdammten Hüftgurt nicht hoch, weil ich einen so fetten Hintern habe. Ich muss den Verschluß lösen, dafür brauche ich beide Hände, das heißt, ich muss die Kette loslassen, an der ich mich mit einer Hand festgeklammert habe. Mein Profi mit Riesenrucksack und Sicherheitsleine zu einem anderen Mitkletterer hilft mir, indem er sich hinhockt und nach unten greift, um den Verschluss zu öffnen, und nachdem ich den Gurt hochgezerrt habe, wieder zu schließen. Er hält Balance mit seinen Füßen und dem Oberkörper, während ich mich noch nicht mal traue, einen Arm zu weit rauszustrecken, aus Angst, es könnte meinen Oberkörper mitreißen und ...
Der Abstieg läuft prima, macht direkt Spaß. Ein-, zweimal muss ich mich an die Kette hängen und mich über ein steiles Stück quasi abseilen, aber ansonsten ist das Klettern die reinste Freude, jetzt wo ich nur noch ein leichtes Unwohlsein verspüre. Es macht mir Freude, die richtigen Stellen zum Absteigen zu suchen, Halt für die Füße und sichere Tritte. Als ich unten ankomme, tun mir zwar die Handinnenflächen vom Festhalten an der Metallkette weh, aber ansonsten fühle ich mich erfrischt und gut unterhalten. Ich bin nicht ein einziges Mal abgerutscht. War doch gar nicht so schwer!

Köln Sülz (2014)
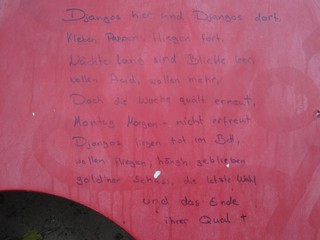
Liebethaler Grund – WAGNERIANA (2016)
Wagner verfolgt mich. Ich kann nicht sagen, dass ich das bedauerlich finde, denn prinzipiell finde ich Wagner gut, aber! Ich habe den Tannhäuser gesehen und war begeistert, aber! Als ich 15 war, erwähnte ich auf die Frage meines Paten, welche (klassische) Musik ich denn möge, unvorsichterweise den Matrosenchor aus dem Fliegenden Holländer ("Steuermann lass die Wacht"), der einzigen Oper von Wagner, die ich zum damaligen Zeitpunkt gehört hatte (und das auch nur teilweise). Die vier CDs, die er mir daraufhin überreichte, glücklich darüber, dass ausgerechnet ich Wagner mochte, besitze ich noch heute.
Gehört habe ich sie nicht. Wagner muss man live erleben.
Wir gingen auch ins Wagnermuseum in Graupa. Graupa? Jepp. Das liegt bei Dresden und nicht weit von dort, im idyllischen Liebethaler Grund, stieß ich auf ein monumentales Wagnerdenkmal im Stil der deutschtümlerischen 1910er. Der Meister trug einen pelzgesäumten, bodenlangen Umhang und es ertönte in Dauerschleife die Prelude aus dem Lohengrin. Ausgerechnet Lohengrin, dessen eigentümlich archaischer, merlinscher Plot damit beginnt, dass Heinrich der Vogler in einem fiktiven Grenzland des großdeutschen Reiches Soldaten gegen die Ungarn aushebt. Heinrich der Vogler, wegen dem Himmler die Stiftskirche von Quedlinburg umgraben ließ. Um dann die Knochen irgendeines armen Würstchens feierlich neu zu bestatten. Die einzige Aufführung des Lohengrin, die ich je gesehen habe, hatte einen sehr beleibten Lohengrin, der so gar nicht wie ein Schwanenritter aussah. Vielleicht mochte ich sie deshalb nicht.
Der erste Eindruck kann ja manchmal entscheidend sein. Aber mit den bombastischen Klängen wagnerianischer Klangkunst im friedlichen Liebethaler Grund beschallt zu werden, wo sich schon die ersten Sandsteinformationen der Sächsischen Schweiz zeigen, kam mir irgendwie falsch vor. Ja, die Musik war toll, ja, die Musik war episch. Aber muss man den Guru der nationalen Seele deshalb behandeln, als habe er das deutsche Volk quasi erfunden? Man kann in Deutschland ja keine zwei Schritte gehen, ohne auf ein Wagnerdenkmal zu treffen. Nibelungenhalle hier, Wagner als Goethe dort. Und das alles nur, weil die Musik toll ist.
Die Storys? Ja, wegen so was wurden früher Leute verbrannt: Irgendwann gegen Ende des 16. Jahrhunderts behauptete Dietrich Innich, Weber aus Mayen, dass der Venusberg keineswegs so heiter und fröhlich wäre, wie immer behauptet werde. Im Gegenteil, darinnen sei es voller Dünste und Dämpfe, man könne kaum die Hand vor Augen sehen, es würde unablässig gebraten und gekocht. Ja, er sei dagewesen, der Berg läge bei Neapel und würde vom Kaiser bewacht und sei nur heimlich zugänglich.
Da er sich damit ja quasi selbst belastet hatte, dauerte es nicht lange, bis auch andere auf die Idee kamen, das Ganze sei keine Spinnerei und in Wirklichkeit habe er in jenem Berg einen Teufelspakt abgeschlossen. Man warf ihm vor, seinen Reichtum in Säcken aus Frau Venus' Berg getragen zu haben. Hinzu kam, dass er ein gemeiner Schuft war, Wolle falsch wog, Pferde stahl und offensichtlich gern Lügengeschichten erzählte. Außerdem war er ein desertierter Söldner. (Die Moral von der Geschicht hat einen Haken, denn Inning wurde nicht hingerichtet, sonder starb, obwohl er als Hexenmeister beschimpft wurde und sich – erfolgreich – vor Gericht dagegen wehrte, 1597 ganz gewöhnlich an der Pest (1)). Aber die Parallelen zum Tannhäuser bleiben: Weltflucht in den Venusberg, unchristliche Vorgänge dort und nachher Verunglimpfung und Mobbing in der Außenwelt. Und Tannhäuser stirbt ja am Ende, nachdem schon Elisabeth für seine Vergebung gestorben ist, die ihm der Papst zuvor verweigerte (2). Und jetzt erkläre mir mal jemand, was an diesen seltsam simplen archaisch-magischen Storys, die sich konsequent jeder christlichen Heilslogik verweigern, denn so deutschnational sein soll? Auf die Antwort bin ich gespannt.
Wie gesagt, Wagner verfolgt mich. Als ich zu Jean Sibelius recherchierte, dem nationalsten aller finnischen Komponisten, der Wagner zwar nicht mochte, aber trotzdem mit ihm in Zusammenhang gebracht wird, weil beide der im 19. Jahrhundert verbreiteten Spezies der Nationalkomponisten angehörten, stieß ich – im Gegensatz zu Deutschland, wo totgeschwiegen wird, dass Wagner ein Rassist und Judenhasser war – auf Gleichmut im Umgang mit bedeutenden Kulturschaffenen mit nachgewiesenem rassistischen Gedankengut.
"Throughout his lifetime, Richard Wagner was a politically-charged figure. Besides his very person, his numerous writings and even his operas have sometimes led to heated political debates. Even today the topic occasionally raises extreme responses. The Jewish question, albeit central, is only one issue relevant here; others include revolution and the relationship to power. With the topic of Wagner and the North we invite speakers to explore the reception and influence of Wagner's manifold political messages in the North with or without relation to his operas." Einleitung zu "Richard Wagner and the North", Internationales Symposium an der Sibelius Akademie in Helsinki, 2003
Es gibt kein Entkommen. Nirgendwo.
(1) 1 Rita Voltmer:Jagd auf "böse Leute". Hexenverfolgungen in der Region um den Laacher See (16.-17. Jahrhundert), in: Plaidter Blätter. Jahrbuch des Plaidter Geschichtsvereins 1, 2003, S. 11-24, abrufbar unter: https://www.historicum.net/themen/hexenforschung/thementexte/regionale-hexenverfolgung/artikel/Jagd_auf_boese/
(2) Wagners Verständnis von Liebe und Hingabe, illustriert durch einen Brief an den französischen König Ludwig II., in dem er Tannhäusers Motivation erläutert.
Mein inniggeliebter, wundervoller Freund!
„Könnt ihr der Liebe Wesen mir ergründen?“ - Nein! - Nur die Liebe selbst kann sich ergründen; was ihr von ihr saget, kann nur ein Gleichnis sein: ihr Wesen selbst kann aber nicht ausgesprochen werden! – Nur Vorgänge und Wandelungen können berichtet werden: der Dichter, will er ein Bild der Liebe entwerfen, kann nicht anders, als treu die Begebnisse darstellen, wie sie sich aus dem innersten Grunde der Liebe auf der Oberfläche des Lebens gestalten. Aus dem tiefen Zwange, der jene Begebnisse gerade so gestaltete, haben wir auf die Gewalt der Macht zu schliessen, welche die Taten und Entschliessungen leitete: aber schnell erkennen wir durch innerste, bewältigende Sympathie, dass diese Macht die unaussprechliche Liebe war. Ja, die eigne Liebe erkennen wir erst vollkommen deutlich an unsren Entschlüssen und Handlungen: die Rätsel unseres eigenen Innern werden uns erst deutlich gelöst, wenn den Begebnissen gegenüber wir zur Entscheidung gedrängt sind, und erst an dem Ausfall der Entscheidung erkennen wir den gebieterischen Haupttrieb der innersten Seele.
Wie glücklich fühle ich mich, mein herrlicher angebeteter Freund, dass ich immer neu wieder die Fähigkeit und Kraft in mir fühle, diesen einzig beseligenden Forschungen nach meinem eignen Inneren mich liebevoll hingeben zu können! Der oft bis zum Tod betrübte Genius meines Lebens weiss, wie Hoffnung und Glauben meinem Herzen entflohen: womit er mich stets wieder in das Leben zurückführte, war nur - die Liebe. Nur an ihr entzündete sich Glaube und Hoffnung wieder neu; erblassen diese, wenn auch lichtlos, doch warm blieb mir immer noch - die Liebe. Sie ist das göttliche Bedürfnis, welches immer neu mein Leben bildet, und ist mir durch ihre Macht nun Glaube und Hoffnung neu gegeben, so drängt es mich jetzt von Neuem, die holde Gewalt zu erfassen, um mich verständnisvoll ihrem erlösenden Zauber hinzugeben. So erfasse ich sie heut’ und frage nach der klaren Bedeutung dieses innersten Bedürfnisses. Welches ist das Verlangen, das, wenn ich es stillen kann, mir allen Glauben und alles Hoffen erfüllt? Was sage ich aus, wenn ich mir sage, dass die Liebe zu meinem erhabenen Freunde mich einzig beglücken kann?
Der besondere Fall macht mir Vieles im Wesen der Liebe klar. Ich kann es deutlich aussprechen, denn es ist mehr als Empfindung, es ist Entschluss und Tat geworden.
Ein Jahr ist es her, dass das, was ich bin, wirken und wirken kann, meine Kunst – mir zur Last geworden war: ich erlag unter dieser Last, und sehnte mich, sie von mir zu werfen. Da rief mich der Engel: Du, mein Herrlicher, tratest zu mir, und riefest -: nimm Deine Last auf und wirf sie in mein Herz: aus ihm soll sie als ein heiliges Göttergeschenk Dir wieder zugetragen werden, das Dich mit mir zu Paradieseswonnen führt!
Seit dieser Zeit hat Alles, was ich sinne, trachte und erstrebe, einen einzigen Zweck: - auf das Innigste zu erfassen, woran das Gefallen meines Freundes haftet, was ihm Freude macht, zu erraten, was Er will, was der Sinn Seines Wünschens und Beliebens ist. Jede Vorstellung meines eigenen Wollens trübt sich sofort, sobald ich mich von diesem einzigen Beweggrunde meines Verlangens, auch nur im Gedanken, entfernen zu wollen scheine. Ich frage mich dann plötzlich, ob all mein Streben und Trachten mir jetzt nur noch denkbar und möglich wäre, wenn diese tiefinnerste Triebfeder plötzlich stockte, wenn das Gefallen meines Freundes nicht mehr der Zweck meines Wollens wäre? O, unmöglich! Dies Eine, und nur dies Eine gibt meinem Streben einen Sinn! Nicht ein Atom von Übertreibung, sondern die einfachste Wahrheit liegt darin, wenn ich es ausspreche: nicht meine Kunst will ich mehr, nicht an der Vollendung, an der Darstellung meiner Werke liegt mir, sondern: ich will tun, was meinem Freunde Freude macht, was Er will, dass ich tun möchte um Gefallen daran zu finden! Wäre dies Blasphemie an meiner Kraft? Ich glaube nicht, dass Jemand noch meinen Tannhäuser getadelt hat, weil er bekennt:
„Ich tat’s, - denn in Zerknirschung wollt – ich büßen, um meines Engels Tränen zu versüßen.“
Hier bekennt Tannhäuser, dass es ihm nicht um sich, um das Heil seiner Seele zu tun war, sondern – um ein einziges seliges Lächeln des Engels, der sich um ihn, um sein verlassenes Seelenheil so tief betrübte; dies, mein holder Freund, ist – Liebe. – Und dies sind die Wunder der Liebe! Und hier hat mich eine augenblickliche Eingebung das Gleichnis finden lassen, welches das Wesen der Liebe in seiner tiefsten Bedeutung erklärt. Hier ward es Tat, was bei Andren nur edle Empfindung der Resignation blieb.
„Inbrunst im Herzen, wie kein Büßer noch sie je gefühlt“ –
vollbringt Tannhäuser das selbstzerfleischende Werk der Sühne: bei jeder Pein, jeder schmerzlichen Demütigung haftet seine Seele nur an dem einen Wunsche, der Geliebten zu gefallen. War dies ein freventlicher Wunsch? Womit einzig konnte die Geliebte erfreut werden? Nur das innerste Seelenheil des Geliebten, nur die Erlösung, die Heiligung des Freundes konnte Elisabeth die „Tränen tiefsten Mitgefühles“ trocknen. Ist Er erlöst, so ist sie selig! So lebt das Heil des Einen nur im Heile des Anderen; und während jedes der Liebenden nur im Heil des Andren besorgt ist, ohne je daran zu denken, fördert es einzig doch sein eignes Heil. Wie? Nur das eigene Heil? – Nein! Seht, - da nahen sie, die Boten des Priesters mit der Verkündigung des göttlichen Wunders: der dürre Stab ist neu gegrünt, allen Sündern der Welt ist Gottes Gnade gewonnen! – Das ist das Werk, dies das Wunder, welches der Welt gewonnen wurde, da, als die Liebenden nur das Heil des Andren erstrebten, ward das Werk der Liebe selbst der Welt gewonnen!
Und dies Werk, - auch wir wollen es der Welt gewinnen! Aus dem Bunde der Herzen, von denen Jedes nur des Andren Wunsch und Willen fördern will, soll das Werk erstehen, das kein Einsamer bereiten kann! Nie, nie möge mein göttlicher Freund auch nur einen Augenblick in dem Bewusstsein schwanken, dass nur Seine Liebe mich begabt, und dass mein Werk nur dann gelingen kann, wenn es nicht mehr mein Werk, sondern das Werk meiner Liebe zu Ihm ist!
Heil! Heil dem Bunde! Selig und ewig beglückt der liebende Geliebte!
Treu und ewig sein Eigen
16. Febr.1865 Richard Wagner
Quelle, S. 6
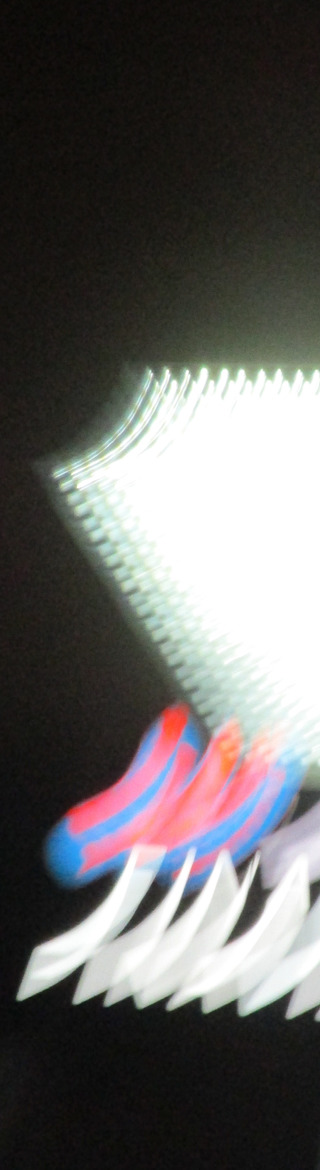
Goetheinstitut Helsinki – SAŠA STANIŠIĆ-LESUNG UNPLUGGED (2016)
Am 22. April hat Saša Stanišić im Goetheinstitut Helsinki gelesen, und zwar "Ich habe mein Herz im Naturpark Neckartal-Odenwald verloren" aus "Wie wir leben wollen", einen Ausschnitt aus "Vor dem Fest", in dem Frau Kranz eine tragende Rolle spielt, und den Anfang von "Georg Horvath ist verstimmt" (und wie!) aus seinem neuen Roman "Fallensteller" (Veröffentlichungsdatum 9. Mai 2016).
Der Autor erprobte dabei eine Art Reenacting des Hörbuchsprechens, nicht langweiliges Richtiglesen, sondern verschluckte Silben, wehende Haare und begeistertes Auf und Ab von Stimme und Körper. Sah anstrengend aus und zwischenzeitlich war ich ganz froh, dass ich beim Zurücklehnen genau vor mir einen Knallkopf hatte, der mir den Blick auf den Autor versperrte.
Der Typ neben mir wippte die ganze Zeit mit dem Knie, besonders während der Fragerunde. Und ich glaube, er hat auch fortwährend gepupst, denn ständig drang so eine Art Geruchswolke zu mir herüber, die man beim besten Willen nicht als gutriechend bezeichnen konnte. Das Goetheinstitut war voll – sehr voll – und als ich, ausnahmsweise pünktlich, sieben Minuten vor Lesungsbeginn herein gestürmt kam, schlug mir eine Alkoholwolke entgegen, die den zahlreichen Weingläsern entströmt sein musste, gehalten von unzähligen Menschen jedes Alters und beiderlei Geschlechts. Es stellte sich heraus, dass es ein Buffett gab, vielleicht sollte ich in Zukunft die Veranstaltungshinweise genauer lesen. Ich schaffte es gerade noch zwei Häppchen zu kosten und mir ein halbes Glas Riesling einzuführen, bevor es losging. Und dann ging es los.
Drei Texte des Bosnier-Serben-Deutschen, alle mit Flucht, Identität, Vertreibung verknüpft. Verkitschte Erinnerungen an ältere Zeiten (so der Autor), Wir-Perspektiven, Sprachspiele und Eheprobleme beim Anflug auf Rio. Später gestand der Autor, der sich zu Beginn noch mit aktuellen Anlässen aus der Affäre zu ziehen versuchte, dass er trotz einer gewissen bevormunderischen biografischen Lesart seiner Texte eigentlich nicht (mehr) von dem Thema weg will, weil es ihn interessiere. Probleme mit dem Begriff Flüchtling scheint er nicht zu haben, aber im laufenden Prozess – also während er laut darüber nachdachte – plädierte er dann doch für Geflüchtete. Aber mehr aus sprachhygienischen Gründen, schien mir.
Das interkulturelle Miteinander der Flüchtlingsgemeinschaft am Heidelberger Stadtrand der 1990er ("Ich habe mein Herz ...") erinnert mich an gelebte Realität. Es ist schön, wenn deutsche Schriftsteller die Multikulturalität verteidigen, aber es ist nicht, dass es etwas Neues wäre. Das Fremde war für einen Teil der Deutschen schon immer am ehesten interessant. Alles, was bereits für mich jetzt durchscheint, Mehrsprachigkeit (die bei einer gewissen Beherrschung die Hierarchien abflacht), das Leben und Integrieren (in) anderer(n) Kulturen im laufenden Prozess, nicht nur als Bereicherung, als Selbstverständlichkeit, die es möglich macht, zu dem einen ja zu sagen und zu dem anderen nein. Die Verwurzlung in der Kindheit und ihren Ausprägungen zusammen mit einer Offenheit für nichthierarchiertes Neues. Für die Generation nach mir wird das einfach das sein, was es für den Autor in den 1990ern schon war: normal. Mit Konflikten, Unverständnissen, Ausklammerungen, aber eben ohne fremd. Von daher stellt sich die Frage nicht, ob Saša Stanišić' Biografie seine Texte beeinflusst oder ob er die Stimme der Geflüchteten sein kann.
Gegen Ende regte sich der Autor dann auch über Maxim Billers "nationalen Zugang zum Schreiben" auf, dass Themen durch und mit der Biografie gefunden und interpretiert werden müssen: Schreibe nur darüber, was du bist. Saša Stanišić wand sich körperlich am Lesepult und wedelte mit den Händen und rief: Das ist ja wie im 19. Jahrhundert! Ich will auch anderes schreiben, ich kann auch anderes schreiben. Nur über sich selbst zu schreiben, ist das schriftstellerische Pendant zum Rassismus (das hab jetzt aber ich gesagt).
Ach ja, und "Georg Horvath" ist recht lustig gewesen, wenn auch nicht zu lustig. Der Humor erinnert mich an Daniel Kehlmann, dessen "Ruhm" zwar technisch eine Meisterleistung, im Leseprozess aber nur mäßig witzig ist. Kein Wunder, dass sich die Deutschen so an Jan Böhmermann abarbeiten. Ein Witz, der auf einem Klischee beruht und zu Lasten einer Figur geht, für die der Autor jedes Verständnis missen lässt, ist doof. Wenn man so was witzig findet, kann man nicht über Böhmermann lachen. In Georg Horvaths Fall ist es seine Ehefrau, die dem Zuhörer seeeehr unsympathisch wird, in nur fünf Seiten. Wenn Georg Horvath den Sex mit ihr so schrecklich findet, dann soll er jemand anderes vögeln. Und sich nicht bevormundet fühlen.
Bleibt Platz für ein klassiches Resume: Das Buffet war gut, der Wein mittelmäßig, die Texte eine Ohrenweide, inhaltlich interessant. Netter Abend.



JavaScript is turned off.
Please enable JavaScript to view this site properly.